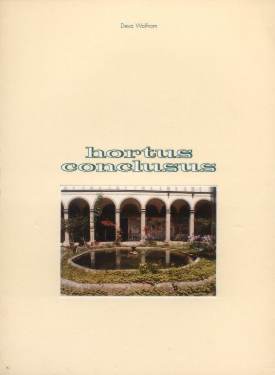
Hortus conclusus in seinen verschiedenen Ausdeutungen
Mit der Unbeherrschbarkeit des Feuers von Tschernobyl 1986 wurde nicht nur unsere äußere Umwelt langfristig angegriffen, sondern ich verlor auch einen inneren Garten. In meinen Lebensträumen entsprach er optisch ungefähr einem Kreuzganggarten und ich nannte ihn hortus conclusus.
1989 stellten wir zum Thema hortus conclusus im Kreuzgang des Klosters Santo Spirito in Florenz aus. Die Ausstellung brachte mich darauf, dass dieser Urklang eine Vielzahl von Aspekten in sich barg.
Es war nicht ohne Reiz, im Maternushaus/Köln sämtliche Lexika der Kunstgeschichte, Kirchenikonographie und Architektur unter den Stichwörtern: Kreuzgang, Klostergarten und hortus conclusus aufzuschlagen, und zwar quer durch die westeuropäischen Sprachen seit dem 18, Jahrhundert. Es schienen fast alle wortgleich voneinander abgeschrieben zu haben. Eine auffallende Veränderung lief nur durch die Zeit: Je älter ein Lexikon war, umso mehr stand zu den Begriffen geschrieben. Es gibt jedoch keine eigene Vokabel für den Gartenteil im Zentrum des Kreuzgangs, außer einer nur einmal erwähnten technischen Umschreibung »Quadrum«, was eben Viereck heißt.
Genauso wenig hatte dieses Viereck einen Namen in Architekturzeichnungen von Klosteranlagen. Bis ins 9. Jahrhundert wurden lediglich die Brunnen in den Kreuzganganlagen erwähnt und beziffert. Ich gestehe, dass ich mich im Verlauf der Suche noch verwundener Enttäuschung immer mehr über das viereckige Loch in der Kunst- und Architekturgeschichte freute! Es hob sich mir geradezu entgegen, um entdeckt zu werden.
Ich belegte das nomenlose Viereck mit dem jungfräulichen Begriff des hortus conclusus und seither springen Funken aus dieser glücklichen Verbindung. Der paradiesische verschlossene Garten hat sich wie eine Schatzkiste geöffnet; nicht nur mir, sondern auch meinen Kolleginnen und Freunden, die Mosaiksteinchen oder ganze Felsbrocken zur Ausdeutung dieses metaphysischen Raums herbeitrugen.
»hortus conclusus« wird in den Lexika einfach als Sinnbild der Jungfräulichkeit Mariens angegeben. Dazu finden wir in spezifischer Literatur symbolische und symbolistische Erklärungen, vielleicht auch noch versteckte Anzüglichkeiten, aber keine explizite Behandlung dieses Begriffs. 1 Auch darüber haben wir uns gefreut.
Beschreibung eines Kreuzganggartens
Viele Regale sind gefüllt mit Schriften zu Marias Empfängnis durchs »Ohr« statt durch die Sexualorgane, ihr Erwählt Sein, sowie die direkten und indirekten Folgen dieser wichtigen Kirchengeschichte auf die Frauen und auf Frau-Mann-Beziehungen. Mir kommt dazu die Vorstellung von einer Bibliothek zu diesem Thema und einer Marienkapelle, die sich seit Jahrhunderten gegenüberstehen und sich wechselseitig beschimpfen: Gelogen! Wahr! Lüge!… Vielleicht haben beide recht. Aber meiner Meinung noch müsste das ganze Streitpaket aus dem öffentlichen Verkehr gezogen und Mystikern übergeben werden — da, wo es herkommt und auch hingehört! Man braucht nur einmal nachzulesen, wie überfordernd unser großer Hausmystiker, Meister Eckhart 2, seine Geistesgaben beugte, um die Jungfräulichkeit als ein nicht-frauspezifisches Phänomen und »Frau sein« als menschliches Reifestadium auszuweisen. Wie viel visionäre Kraft mag nötig sein, so ein komplexes Menschheitsbild zu fassen, geschweige denn in Worte zu fassen?! Verlassen wir also Maria mit ihrem kirchlich- männischen Problem und entdecken lieber die Dimensionen des hortus conclusus.
Ich beschreibe Ihnen einen Kreuzgang: Es ist ein Hof zwischen der Kirche einerseits, als Ort der geistigen Nahrung und dem Refektorium andererseits, dem Ort körperlicher Nahrung. Ein Wandelgang führt im Quadrat um den inneren, meist abgeschlossenen oder irgendwie abgetrennten »Garten«. In dessen Mitte steht ein Brunnen – ein Quell aus der Tiefe, ein »Spiegel des Himmels«. Von dem Brunnen aus — in der Mitte der Anlage — sieht man meist den Kirchturm, ein Richtungszeichen noch oben. Beide lassen sich auch begreifen als generatives Element.
Auffindung und Bezeichnung von besonderen Plätzen
Neben dem Brunnen befand sich häufig ein Juniperus Sabina (Giftwacholder). Dieser Baum wird auch heute noch auf Friedhöfen angepflanzt und galt von jeher als wirksames Mittel gegen »böse« Geister und als Abtreibungsmittel. 3
Von dem zentralen Brunnen aus führen vier Wege in die vier Himmelsrichtungen. Wir dürfen gleichermaßen die vier Flüsse in ihnen sehen, die von der einen Quelle ausgehen. Alles in allem haben wir es hier mit einer stilisierten Darstellung des biblischen Paradieses zu tun, einem wahrlich verschlossenen Paradies. Denn bis heute darf in der Regel kein Tourist diesen Bereich betreten. Das Wissen um diese sinnbildliche Anordnung ist selbst aus dem Bewusstsein der Ordensbrüder und -Schwestern verschwunden.
Schaut man im Wörterbuch unter dem Architekturbegriff »Paradies« noch, handelt es sich um eine völlig andere Anlage, eine Ablenkung vom hortus conclusus. Weiterhin ist das »Paradiesgärtlein« ein Buch, nämlich ein Knigge für junge Nonnen aus dem Mittelalter von Herrad von Landsberg.
Innenhöfe gab es schon immer in sakralen und profanen Bauten. Allein um die Regenwasserprobleme zu lösen oder genüsslich philosophierend vom Schatten des Wandelgangs aus einen rechteckig ausgeschnittenen Himmel bestaunen zu können. Aber wir wissen, dass heilige Plätze eine so lange Geschichte hoben wie die Menschheit selber. Im alten Testament steht geschrieben, dass der Platz erst visionär geschaut werden musste und noch der Auffindung mit einem gesalbten Stein bezeichnet wurde, die Regeln unserer vorchristlichen Eltern.
Umgang im immaginierten hortus conclusus
Unter fast jedem toskanischen Altar dieses Jahrtausends steht ein römischer Altar, darunter ein etruskischer und darunter stehen noch Berge von gesalbten und inzwischen zerkrümelten Steinaltären anderer Menschengeschlechter. Bei Don Juan (Carlos Castañeda) können Sie nachlesen, wie anstrengend und auch wie erlösend es ist, den richtigen Platz zu finden. Wie in Thomas Mann »Josef und seine Brüder« der Abraham im Abraham im Abraham steckt, von denen jeder seinen Teil zur Gesamtfigur beigetragen hat und jeder selber die Gesamtfigur ist, so birgt auch die letzte, jüngste Gestalt des sakralen Ortes seine älteste und alle Zwischenstadien. Wir Künstlerinnen stehen somit vor einem schier unerschöpflichen Brunnen der Menschheitssehnsüchte und Geistesgeschichte, deren Zeichen zu steiniger Gestalt geworden verstehbar und nutzbar werden für den, der hinhören mag und kann. In diesem Sinne entstanden die Arbeiten zur Ausstellung von 1989 in Santo Spirito.
Die Weiterentwicklung dieses Themas fand in Köln statt. In Gedanken durchlebten Frau Burgmer und ich in der Bibliothek des Maternushauses die Baugeschichte von Sankt Peter und besonders Auf- und Niedergang des Kreuzgangs durch die Jahrhunderte. Wir haben ihn vor unseren inneren Augen für immer a verschwinden sehen. Hier beginnt unser neuer hortus conclusus: Es gibt nicht einmal mehr architektonische Zeugen. Zukunft und Vergangenheit fallen aufeinander. über den hortus conclusus von St. Peter trampelt heute die Sternengasse geradlinig hinweg. Der hortus conclusus besteht jetzt aus vollständig erodierten, gesalbten und in der Kirchenwand verbauten Steinen, das heißt, der Garten ist unsichtbar wie mein verlorengegangener innerer Garten und wie die Weit, die der Künstler zu visualisieren versucht.
Der Umgang mit dem Unsichtbaren entspricht dem Umgang im immaginierten hortus conclusus des Sankt Peter und erinnert mich an das »Orgelspiel« von Hermann Hesse. In diesem Gedicht wird die Erfindung der Orgel beschrieben und auch die Orgelbaumeister, die Komponisten und die Organisten bis hin zu dem Moment, in dem die Orgel endlich in der Kirche erklingt:
»… Denn derselbe Geist, der in den Fugen und Toccaten atmet, hat einst die besessen, die des Münsters Maße ausgemessen, Heiligenfiguren aus Steinen schlugen …«
Dann verändert sich die Weit durch Krieg und Desinteresse:
»… Kurz ist das Leben und es ist nicht Zeit, sich hinzugeben so geduldig komplizierten Spielen …«
Und dennoch gibt es die Orgel mit ihrer Musik:
»… Und so fließt im unterirdisch Dunklen ewig fort der heilge Strom, es funkeln
aus der Tiefe manchmal seine Töne,
wer sie hört, spürt ein Geheimnis walten, sieht es fliehen, wünscht es festzuhalten, brennt vor Heimweh. Denn er ahnt das Schöne.«
Orientierung im Unsichtbaren
Der Mystiker Juan de Ja Cruz hat diese Dimension so beschrieben:
»… willst du zu dem gelangen, was du nicht weißt, musst du hingehn, wo du nichts weißt. Willst du zu dem gelangen, was du nicht besitzest, musst du hingehn, wo du nichts besitzest …«
Wie orientiert man sich in dieser übervollen, unsichtbaren Welt? Dr. Berk los in der Genesis noch über die Vertreibung aus dem Paradies und, siehe da, es fand sich kein Name, kein Wort für den Bereich, in den sie vertrieben wurden, für dieses Nicht-Eden. Spätestens seit Meister Eckhort wissen wir, wie verhängnisvoll dieses »Nicht« ist und ganz dem Verhängnis unserer Weit entspricht.
Meister Eckhart: »… Drittens musst du frei sein vom »Nicht«. Man fragt, was in der Hölle brennt. Die Meister antworten alle, Das tut der Eigenwille. Ich aber sage wahrheitsgemäß, dass das »Nicht« in der Hölle brennt. Höre dazu ein Gleichnis: Man nehme glühende Kohle und lege sie auf meine Hand. Würde ich nun sogen, die Kohle brenne meine Hand, so täte ich ihr sehr unrecht. Soll ich ,genau sagen, was mich brennt? Es ist das »Nicht«, denn Kohle hat etwas in sich, was meine Hand »nicht« hat. Seht, eben dieses »Nicht« brennt mich. Hätte meine Hand all das in sich, was Kohle ist und leisten kann, dann hätte sie ganz und gar die Natur des Feuers* Nähme einer dann alles Feuer und schüttete es auf meine Hand, es könnte mich nicht schmerzen … «
Es gilt also nichts weniger, als in dem »unsichtbaren Viereck« die Weit zu entdecken, ihr einen Namen zu geben und sie vom »Nicht« zu befreien. Damit komme ich zurück zum Anfang: Die Radioaktivität von Tschernobyl ist nur eine der jüngsten Manifestationen des ewigen Kampfes zwischen Eden und Nicht-Eden, zwischen Utopie und realen Lebensbedingungen, zwischen freifließender Energie und Widerstand. Hortus conclusus ist Ausdruck dafür, wie sich extreme Ebenen durch schöpferisch-künstlerische Prozesse in erfahrbare und lebbare Beziehung bringen.
Deva Wolfram
1 Das Thema der »Madonna im Rosenhag« oder, eng mit dieser verwandt und häufig sogar verschmolzen, der Madonna im verschlossenen Garten, im »hortus conclusus«, der sowohl von einer Hecke als auch von einer zinnenbewehrten, mit Türmen verstärkten Stadtmauer umgeben sein kann — ist uns durch eine Reihe spätgotischer Bildtafeln von Stefano da Zevio bis Martin Schongauer zu einem so vertrauten, ja geradezu selbstverständlichen Teil der spätmittelalterlichen lkonographie geworden, dass das durchaus Ungewöhnliche dieser Bildvorstellung meist gar nicht mehr bewusst wird. Tatsächlich aber lässt sich die Darstellung der Madonna im Rosenhag eindeutig weder auf einen textlichen Vorwurf der Heiligen Schriften noch auf eine bestimmte Anregung aus der theologischen Literatur des Mittelalters beziehen, im Gegenteil: Die Entstehung dieser Bildvorstellung, bis heute weder noch Zeit noch Ort eindeutig geklärt, dürfte außergewöhnlich kompliziert, d.h. den verschiedensten Quellen verpflichtet sein. Manfred Wundram: Stefan Lochner »Madonna im Rosenhag«, Stuttgart 1965.
2 Hier Meister Eckhart zur Bedeutung von Jungfrau und Frau:
Gebt nun auf dieses Wortbesondersacht: Der Mensch, von dem Jesus empfangen wurde, musste unbedingt eine Jungfrau sein. »Jungfrau« – das heißt hier ein Mensch, der von allen bildlichen Vorstellungen befreit ist. Er muss so frei sein, wie er war, als er noch gor nicht existierte. Da könnte man nun (zu Recht) fragen: wie kann ein Mensch, der geboren ist, sich entwickelt hat und vernünftig wurde, wie kann ein solcher so frei sein von allen bildlichen Vorstellungen (im religiösen Bereich) wie vor seiner Geburt? Er weiß doch vieles, und alles, was er weiß, ist von Vorstellungen begleitet; wie kann er davon frei sein?
Hört zu, genau das will ich euch erklären. Hätte ich einen so umfassenden Geist, dass er alle Vorstellungen, die je Menschen begriffen hoben, und alle Ideen, die in Gott selbst sind, umgreifen könnte, doch so, dass ich dabei frei von einer Bindung meiner selbst an diese Ideen wäre, dass ich keine davon im Tun und Lassen, zum Vorteil oder Nachteil als mein eigen betrachten würde, dass ich vielmehr in diesem Augenblick völlig frei wäre für den geliebten Willen Gottes und diesen unaufhörlich zu erfüllen trachtete (sich in mir erfüllen ließe), in der Tat: dann wäre ich »Jungfrau« im Sinne völliger Freiheit und ohne Behinderung durch alle Vorstellungen und Ideen, und dies wäre ich jetzt ebenso gewiss, wie ich es war, bevor ich existierte.
Ich behaupte ferner: Dass so ein Mensch »Jungfrau« ist, das nimmt ihm von allen Werken, die er einmal getan hat, nichts weg; aber es lässt ihn zugleich gehorsam und frei sein. Nichts behindert ihn an der Berührung mit der höchsten Wahrheit, so wenig wie Jesus, das Urbild ganzer Freiheit und vollen Gehorsams (behindert wurde). Die Philosophen sagen, dass nur Gleiches sich mit Gleichem verbinden kann und darum muss der Mensch, der den freien und gehorsamen Jesus empfangen will, selbst frei und gehorsam, »Magd« und »Jungfrau« sein. Nun müsst ihr aber genau zuhören! Wäre der Mensch stets in diesem Sinne »Jungfrau«, er würde nichts hervorbringen, sondern bliebe unfruchtbar. Wenn er Früchte bringen will, so muss er unbedingt auch zur »Frau« werden. »Frau« oder »Weib« ist der erhabenste Name für die Seele, viel schöner noch als »Jungfrau«.
Meister Eckhart: Das Buch der göttlichen Tröstung, Frankfurt 1987
3 Der Sadebaum Juniperus Sabina L.
Das am häufigsten zur Fruchtabtreibung gebrauchte Mittel ist unstreitig die Sabina (Sadebaum, Sevenbaum, Sayling, Segelesboum, in manchen Gegenden auch Segenbaum genannt). Uralt ist der Ruf dieser Pflanze als Abortivum. Schon Dioskorides sagt von ihr: Sabina et partus opposita extrahit, et suffitu idem preestat, und Galen: Sabina foetum viventem interficit et mortuum educit.
Auch Avicenna, und in späterer Zeit Fernehus und Matthiolus sprechen von der abortiven Wirkung der Sabina. Die heilige Hiidegardis gedenkt des Strauches unter dem Namen Sybenbaum, ohne jedoch seinen Missbrauch als Abortivum zu erwähnen.
Karl der Große trug im 9. Jahrhundert durch Aufzählung des Strauches in seinem »Capitulare« zu seiner Kultur im Norden der Alpen bei. In England scheint der Strauch schon vor der Eroberung durch die Normannen kultiviert und benutzt worden zu sein.
Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war der Verkauf des Sevenbaumes in den österreichischen Staaten streng untersagt. Unbegreiflich ist es, dass A. v. Holler die Sabina für unschuldiger als die von ihm für wirkungslos erklärte Euphorbia palustris hielt. Dass die Sabina noch gegenwärtig als das beliebteste Abortivmittel bekannt ist, braucht kaum noch dem bereits Mitgeteilten erwähnt zu werden.
Am Ende des 18. Jahrhunderts schrieb ein Göttinger Professor: »Wenn ich in Schwaben aufs Land reisete und an einem Dorfgarten vorbeikam, in welchem ich einen Sewen-Baum oder -Busch sahe, so wußte ich aus vielen Fällen, wo meine Vermutung eingetroffen war, schon, dass der Garten dem Barbierer oder der Hebamme des Dorfes gehöre. Zu welcher guten Absicht mag wohl der Sewenbaum so sorgfältig gepflanzt werden? – Betrachtet man diese Bäume oder Stauden, so sind sie gewöhnlich ihrer Krone beraubt und verküppelt, weil sie so oft berupft, auch mitunter bestohlen worden.«
Man darf annehmen, dass bei Frauen mit großem Körperbau und erregbarem Temperament eine konzentrierte Abkochung, oder besser ein Aufguss von 50-70 g der Sadebaumspitzen Abort veranlassen kann. Fette, phlegmatische Personen werden mehr davon gebrauchen.
Zuverlässigen Untersuchungen nach enthält das Sodebaumöl 25% eines Terpens und einen ungesättigten Alkohol, das Sabinol, welches durch Oxydation mit neutraler Kaliumpermonganatlösung in die zweibasische Säure übergeführt werden kann. Diese ist identisch mit der a-Tanoacetogendikorbonsäure. Auch Essigsäure neben zwei anderen Säuren fanden sich in dem Sabinaöl. Das wirksame Prinzip stellt das Sabinol, ein farbloses Öl dar.
Versuche an Kaninchen zeigten, dass Sabina eines der wirksamsten wehenbefördernden Mittel ist, und sogar noch Sekale hierin übertrifft.
L. Lewin: Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel. 4. Auflage Berlin 1925
